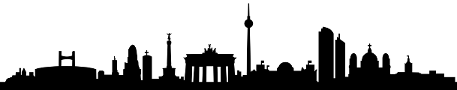Wie man eine Kirche (auch) sehen kann
Oder: Theologie in Stein
Unter diesem sicherlich ungewöhnlichen Titel möchte ich einen subjektiven Blick auf die Kirche in Karlshorst werfen. Jede Kirche ist mehr als nur ein Funktionsraum, der Raum für die Versammlung der Gemeinde bieten soll. Jede Kirche ist auch Symbolraum: nicht nur ihre zentrale Ausstattung – v.a. Altar, Taufbecken – wollen auf etwas jenseits ihrer praktischen Nutzbarkeit verweisen; auch das Gebäude selbst wird immer wieder gern für Verweise und Anspielungen auf Vorstellungen der christlichen Gedankenwelt genutzt.
Gebäude, Räume wahrzunehmen, kann somit dazu beitragen, sie (intensiver) zu erfahren, sie bewusster zu nutzen. Symbolische Verweise können weitergedacht werden.
Vorwissen ist sicherlich hilfreich dabei, aber Neugier und Beobachtung sowie Assoziieren machen die Betrachtung erst lebendig. Einzelelemente und übergreifende Strukturen und Verweis(system)e, Nebenordnung und Über-/Unterordnung erhalten ihren Platz und Sinn durch den Betrachter.
I Eine Annäherung
 Aus der Entfernung schon reckt sich der Kirchturm mit dem Kreuz selbstgewiss in die Höhe über den Stadtteil. Von der Treskowallee führt wie eine herrschaftliche Allee die Bopparder Straße nach Osten auf den massigen Turm mit dem überlangen Helm zu. Wie bei einem Gehöft eine Einfassung mit einer Natursteinmauer, aber kein eigentliches Hoftor: Zwischen zwei niedrigen Naturstein-Pfeilern geht man zu Fuß die zwei Stufen zum Vorplatz hinauf. Auf den Pfeilern Gefäße, die an Feuerschalen eines Heiligtums denken lassen, doch mit Blumen gefüllt sind. Die Anordnung der Bäume erinnert an heilige Haine.
Aus der Entfernung schon reckt sich der Kirchturm mit dem Kreuz selbstgewiss in die Höhe über den Stadtteil. Von der Treskowallee führt wie eine herrschaftliche Allee die Bopparder Straße nach Osten auf den massigen Turm mit dem überlangen Helm zu. Wie bei einem Gehöft eine Einfassung mit einer Natursteinmauer, aber kein eigentliches Hoftor: Zwischen zwei niedrigen Naturstein-Pfeilern geht man zu Fuß die zwei Stufen zum Vorplatz hinauf. Auf den Pfeilern Gefäße, die an Feuerschalen eines Heiligtums denken lassen, doch mit Blumen gefüllt sind. Die Anordnung der Bäume erinnert an heilige Haine.
Meist leicht beschattet zeigt sich nun ein Raum von anderem Charakter. Das links an das Seitenschiff anschließende Nebengebäude besitzt kein Gegenüber; stattdessen erstreckt sich der Vorplatz L-förmig entlang des Kirchenschiffes bis zum Pfarrhaus. Kein herrschaftlicher dreiseitiger Ehrenhof wird von den Gebäudeteilen aufgespannt. Vielmehr zeigt die Anlage sich wie ein Landhaus um 1900 mit großzügigen Nebengelassen. Es ruft in Erinnerung, dass Karlshorst zur Zeit der reformerischen Gartenstadt-Bewegung angelegt wurde. Das große, aufgespannte Tuch mit der Orgelabbildung gibt neben dem Schaukasten einen diskreten Hinweis auf die kirchliche Nutzung.
 Aus der Nähe tritt die Backsteinmasse des Turms in den Hintergrund und das Portal in einem Vorbau kommt in den Blick. Als wolle es sich bewusst bürgerlich-bescheiden geben, überragen die schlichten, rechteckigen Türflügel kaum die Seitentür. Doch ihre wuchtige Einfassung mit Rundbogen betont die Würde des Hauses und scheint hineinzuziehen. Leicht hervortretend gibt ein Relief schon einen konkreteren, wenngleich immer noch diskreten Hinweis auf die Bestimmung: Ein Pelikan ernährt aus seinem eigenen Blut und Fleisch seine Jungen. Eine antike Vorstellung, die schnell als Symbol für Gottes Liebe zu den Menschen in Jesu Tod verstanden wurde. Vertrauter sind dann das Lamm Gottes mit Kreuzesfahne als Sieger über den Tod und eine aufsteigende Taube, der Friede Gottes, in seitlichen Medaillons. Nach diesen Andeutungen zum Wesen Gottes, im Bogenfeld zwei kniende Gestalten: Hoffen und Beten als zwei Haltungen, wie sich der Mensch Gott nähern kann.
Aus der Nähe tritt die Backsteinmasse des Turms in den Hintergrund und das Portal in einem Vorbau kommt in den Blick. Als wolle es sich bewusst bürgerlich-bescheiden geben, überragen die schlichten, rechteckigen Türflügel kaum die Seitentür. Doch ihre wuchtige Einfassung mit Rundbogen betont die Würde des Hauses und scheint hineinzuziehen. Leicht hervortretend gibt ein Relief schon einen konkreteren, wenngleich immer noch diskreten Hinweis auf die Bestimmung: Ein Pelikan ernährt aus seinem eigenen Blut und Fleisch seine Jungen. Eine antike Vorstellung, die schnell als Symbol für Gottes Liebe zu den Menschen in Jesu Tod verstanden wurde. Vertrauter sind dann das Lamm Gottes mit Kreuzesfahne als Sieger über den Tod und eine aufsteigende Taube, der Friede Gottes, in seitlichen Medaillons. Nach diesen Andeutungen zum Wesen Gottes, im Bogenfeld zwei kniende Gestalten: Hoffen und Beten als zwei Haltungen, wie sich der Mensch Gott nähern kann.
II Beim Betreten
 Der Durchgang gerät dann wie in einem Nadelöhr. Unerwartet betont wird die Weitung des Raumes durch das quer gelagerte Tonnengewölbe. Es nimmt dieser Vorhalle den Eindruck, nur Verbindungsraum zwischen Draußen und Drinnen zu sein, indem es sich quer zur axialen Ausrichtung zwischen Außentür und der Pendeltür setzt. Rechts ein raumgreifender, hüfthoher, flacher Tisch, meist parallel zu jener Achse – links etwas mehr Raum und eine oft nur angelehnte Tür zu den Nebenräumen: man wird erinnert, dass sich ein Nebengebäude anschließt; der Blick wird dorthin geleitet.
Der Durchgang gerät dann wie in einem Nadelöhr. Unerwartet betont wird die Weitung des Raumes durch das quer gelagerte Tonnengewölbe. Es nimmt dieser Vorhalle den Eindruck, nur Verbindungsraum zwischen Draußen und Drinnen zu sein, indem es sich quer zur axialen Ausrichtung zwischen Außentür und der Pendeltür setzt. Rechts ein raumgreifender, hüfthoher, flacher Tisch, meist parallel zu jener Achse – links etwas mehr Raum und eine oft nur angelehnte Tür zu den Nebenräumen: man wird erinnert, dass sich ein Nebengebäude anschließt; der Blick wird dorthin geleitet.
Erst sobald die weißen Schwingtüren geöffnet sind, wird durch das hindurch scheinende Licht sichtbar, wo sich der Hauptraum befindet; dass es tatsächlich eine Quer- und eine Längsachse im Vorraum gibt.
An dieser Stelle fühlt es sich weniger als Nadelöhr an – mehr als Ende eines Tunnels, hinter dem das Licht entgegen scheint: Der Durchgang weitet sich zum Licht, der Altarraum und – das Altartuch kommen entfernt in den Blick. Noch unter der Orgelempore wird die Ausrichtung deutlich: Gestühl unten und Geländer der Emporen oben weisen in ihrem dunklen Anstrich vor den hellen Wänden wie Leitplanken den Weg zum Altarraum. Oberhalb wölben sich zwei Kuppeln mit großen Leuchtern, die leicht als Dornenkronen gedeutet werden können. Sie schweben über uns, wir stehen und gehen auch unter Jesu Leiden.
III Am Altar
 Der Altarraum wäre dann die Fortführung der zwei Kuppelräume: durch Leiden und Tod – die zwei Dornenkronen – führt der Weg zur Auferstehung – das Altartuch, in dessen Zentrum die Himmelfahrt Jesu. Das rote Tuch und der Teppich auf den Altarstufen – diese Farbe einzig hier – weisen auf den Altar dazwischen. Dieser wird geometrisch recht streng von der Kanzel zu seiner Rechten und dem Taufbecken zu seiner Linken gerahmt: durch das Wort (Predigt) bzw. die Taufe kann man demzufolge zur Gemeinschaft am Altar kommen.
Der Altarraum wäre dann die Fortführung der zwei Kuppelräume: durch Leiden und Tod – die zwei Dornenkronen – führt der Weg zur Auferstehung – das Altartuch, in dessen Zentrum die Himmelfahrt Jesu. Das rote Tuch und der Teppich auf den Altarstufen – diese Farbe einzig hier – weisen auf den Altar dazwischen. Dieser wird geometrisch recht streng von der Kanzel zu seiner Rechten und dem Taufbecken zu seiner Linken gerahmt: durch das Wort (Predigt) bzw. die Taufe kann man demzufolge zur Gemeinschaft am Altar kommen.  Die Taufe wird dann noch einmal genauer gedeutet: „Matthäus 28,18-20“ – der sogenannte Missionsbefehl – ist oben eingekerbt; seitlich sieht man eine herabsteigende Taube sowie ineinander gewundene Fische: Die Evangelisten – sonst beliebt als Zeugen des Lebens Jesu – spielen keine Rolle, die Taufe ist als ein Ereignis von Wasser (Fische) und des Heiligen Geistes gedeutet. Auch die Kanzel lässt Raum für In-Spiration von oben in ihrer Ausführung ohne Schalldeckel. Wie als solle eine Art von christlicher Lebenslauf ausgedrückt werden, wirken die drei Elemente in ihrer Höhe angeordnet, alle bereits zwei Stufen erhoben: zunächst die Taufe der Kinder, zwei weitere Stufen höher die Gemeinschaft am Altar mit der Konfirmation und – gut evangelisch – vier Stufen höher die Kanzel für das (Hören auf und) Nachdenken über Gottes Wort des Erwachsenen.
Die Taufe wird dann noch einmal genauer gedeutet: „Matthäus 28,18-20“ – der sogenannte Missionsbefehl – ist oben eingekerbt; seitlich sieht man eine herabsteigende Taube sowie ineinander gewundene Fische: Die Evangelisten – sonst beliebt als Zeugen des Lebens Jesu – spielen keine Rolle, die Taufe ist als ein Ereignis von Wasser (Fische) und des Heiligen Geistes gedeutet. Auch die Kanzel lässt Raum für In-Spiration von oben in ihrer Ausführung ohne Schalldeckel. Wie als solle eine Art von christlicher Lebenslauf ausgedrückt werden, wirken die drei Elemente in ihrer Höhe angeordnet, alle bereits zwei Stufen erhoben: zunächst die Taufe der Kinder, zwei weitere Stufen höher die Gemeinschaft am Altar mit der Konfirmation und – gut evangelisch – vier Stufen höher die Kanzel für das (Hören auf und) Nachdenken über Gottes Wort des Erwachsenen.
Wendet man sich dann zurück, so zeigt sich eine geschlossene Ansicht: von drei Seiten umfangen die Sitzplätze der Gemeinde auf den Emporen den Raum – die vierte Seite wird von der Gott geweihten des Altars gebildet.
Auch die Orgel mit ihrem ganz anders gestalteten Prospekt kommt in den Blick: der Blick zurück ist hier im besonderen Sinne einer in die Geschichte, der zudem die Fruchtbarkeit einer (andauernden kirchenmusikalischen) Tradition in Erinnerung ruft.
Markus von Kiedrowski